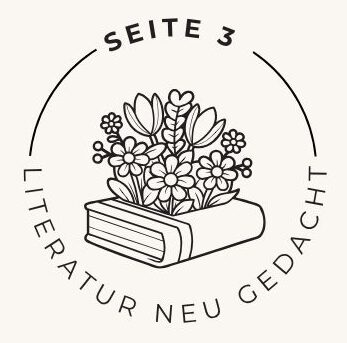Groß denken, groß schreiben – mit Edith Södergran
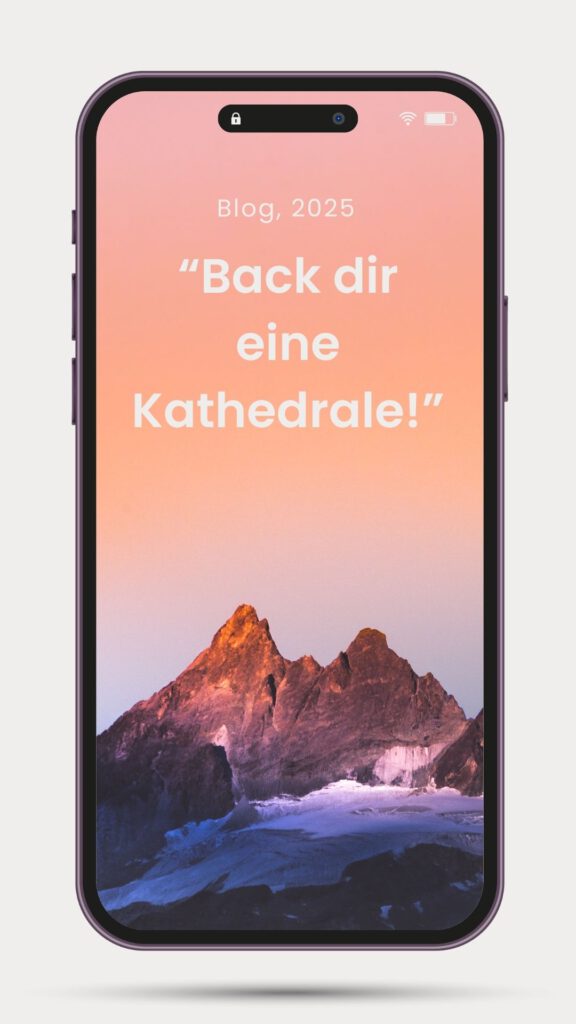
Bild: Canva
Kennst du das Gefühl, medial verschlungen zu werden? Wenn man all die professionellen Social-Media-Posts durchscrollt und das eigene kreative Schaffen plötzlich bedeutungslos erscheint?
In solchen Momenten bietet uns Edith Södergran (1892 – 1923) eine großartige Lektüre. Es lohnt sich wirklich, das Smartphone beiseite zu legen und stattdessen im Werk dieser skandinavischen Dichterin zu blättern. Denn ihre Lyrik liest sich wie ein Stoßgebet für unser Selbstbewusstsein: Sie ruft dazu auf, unbedingt an das eigene Können zu glauben – egal, wie trostlos die Realität gerade aussieht.
Hier kommt eine – völlig unbescheidene – Kostprobe:
„Ich bin keine Frau. Ich bin ein Neutrum.
Ich bin ein Kind, ein Page und ein kühner Entschluß,
ich bin ein lächelnder Streifen einer scharlachroten Sonne (…)
ich bin ein Sprung in die Freiheit und das Selbst …Ich bin des Blutes Flüstern im Ohr des Mannes,
ich bin ein Fieber der Seele, Sehnsucht und Verweigern des Fleisches,
ich bin ein Eintrittsschild zu neuen Paradiesen.
Ich bin eine Flamme, suchend und furchtlos,
ich bin ein Wasser, tief aber dreist bis an die Knie,
ich bin Feuer und Wasser ehrlich vereint in freiem Entschluß …“ (1)
Wer schreibt so? Wer hat diese Tonality, die es locker mit jedem prahlenden Post und vor Ego strotzenden Blog aufnehmen könnte?
Edith Södergran (1892 – 1923) war eine finnlandschwedische Dichterin, die heute als Pionierin der modernen nordischen Lyrik gilt. In lebendigen und frei assoziierenden Bildern schildert sie ihre Welt, die von Krankheit, Einsamkeit und Armut geprägt war – und trotzdem fast vor Selbstbewusstsein platzt.
Im Feuermeer des Lebens
Ihre Eltern legten den Grundstein für eine literarische Karriere: Edith Södergran stammte aus einem gebildeten Elternhaus. Die Familie lebte in einer Villa am Onkamo-See in Raivola – ein finnischer Urlaubsort, der als „Riviera der Zarenzeit“ galt.
Mutter Helena las ihr deutsche Märchen vor und sorgte dafür, dass Edith als Zehnjährige auf eine deutsche Eliteschule in St. Petersburg wechselte. Kein Wunder, dass Edith Södergran später mit Begierde Heinrich Heine und Friedrich Nietzsche las. Ihre ersten Gedichte schrieb Edith Södergran übrigens auf Deutsch – und bezeichnete es als ihre „beste Sprache“ (2).
Als ihr Vater an Lungentuberkulose erkrankte, war sie erst fünfzehn Jahre alt. Ein Jahr später bekam sie die gleiche Diagnose. Von nun an verbrachte sie viel Zeit in Sanatorien – und schrieb.
Ediths Lyrik ist von überwältigenden Gefühlen geprägt, zu denen Expressionismus und Symbolismus wunderbar passen. Beispielsweise schreibt sie als junges Mädchen über ihre Menstruation, die sie mit einem Sonnenuntergang vergleicht. Alles kreist um Individualität, mystisches Erleben und die unbeugsame innere Kraft der Frau, der selbst der Tod nichts anhaben kann.
Große Lyrik, geringe Performance
Trotzdem war Edith Södergran zu ihrer Zeit eine Außenseiterin. Denn ihr avantgardistischer Stil wurde von der damaligen Kritik komplett missverstanden. Sie ließ die Tradition hinter sich, brauchte keine festen Rhythmen und Reime und irritierte auch mit ihrer persönlichen, überaus selbstbewussten Themenwahl. Sie traf einfach nicht die Erwartungen der Leserschaft – und wollte es auch gar nicht.
Kurz nachdem die 24-Jährige ihr erstes Buch „Gedichte“ (1916) veröffentlicht hatte, veränderte sich ihr Leben nochmals rapide zum Schlechten: Die russische Oktoberrevolution beendete das Zarentum – Edith und ihre Mutter, die ihr gesamtes Vermögen in russische Staatsanleihen gesteckt hatten, rutschten an den Rand der Armut. Teure Kuren in der Schweiz waren nun nicht mehr drin.
Nur eine Freundin, die finnische Schriftstellerin Hagar Olsson, unterstützte sie, auch wenn sie auf privater Ebene oft von Ediths besitzergreifender Art überfordert war. Schon bei ihrem ersten Besuch bat Edith die Kollegin ungeniert darum, ein Stück Seife mitzubringen – ihre finanzielle Situation war auf dem Tiefpunkt – und sie schrieb ihr:
„Ich beginne gleich mit meiner Offensive, ich möchte, daß Sie mich als den sehen, der ich wirklich bin, und Sie sich mir als den zeigen, der Sie sind. Können wir so göttlich miteinander umgehen, daß alle Schranken fallen? (…) Sind Sie das Feuermeer, in das ich tauchen möchte?“ (3)
Obwohl Edith schwer krank war und in einem unbedeutenden Provinznest lebte, hinderte sie nichts daran, in ihrem Zimmer Gedichte zu schreiben, die vor Kraft bersten. In ihrer Einleitung zum zweiten Gedichtband „Septemberlyra“ (1918) erklärt sie:
„Meine Selbstsicherheit beruht darauf, daß ich meine Dimensionen entdeckt habe. Es steht mir nicht zu, mich kleiner zu machen als ich bin.“ (4)
Der feuilletonistische Shitstorm ließ nicht auf sich warten: Ihre außergewöhnliche Lyrik wird als Selbstüberhöhung gewertet, als „Verse eines nietzscheverrückten Frauenzimmers“ und „Lachpillen einer Wahnsinnigen“ verspottet. (5)
Es ist, als habe Edith Södergran einen Blick voraus geworfen und genau gewusst, dass sie heute als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen der nordischen Moderne gefeiert wird.
Die Freiheit unserer digitalen Welt
Stell dir vor, Edith würde in unserer Zeit leben: Vielleicht betriebe sie von ihrem Krankenbett aus einen Social-Media-Kanal und schickte ihre bestärkenden Botschaften rund um den Globus! Schließlich passen Ediths Arbeitsweise und Selbstverständnis genau in unsere moderne Welt – man könnte sagen, sie war ihren Zeitgenossen um hundert Jahre voraus.
Besonders dieses Gedicht zeigt, wie originell und energiegeladen Edith Södergran ihr eigenes Schaffen in Szene setzt:
„Ich will ungeniert sein –
darum pfeife ich auf edlen Stil,
die Ärmel kremple ich auf.
Ich bin eine Bäckerin mit heißen Wangen.
Der Teig des Gedichtes gärt …
O ein Kummer –
Daß ich keine Kathedrale backen kann …
Hoheit der Formen –
inständiges Sehnsuchtsziel.
(…)
Bevor ich sterbe,
backe ich eine Kathedrale.“ (6)
Es gibt also keinen Grund, als Künstler/in zurückhaltend zu sein: Edith Södergran fordert uns heute dazu auf, uns auszuloggen, um in aller Ruhe die eigene Kreativität zu kneten, unsere Ideen gären zu lassen und sie dann in maßlose Formen zu bringen.
Ihre Botschaft lautet: Anstatt die endlose mediale Selbstbeweihräucherung zu verfolgen, können wir einfach unsere eigene Kathedrale in den Ofen schieben.
Denn heute ist der perfekte Tag für einen kühnen Entschluss!
Quellenangaben:
(1) Södergran, Edith: „Vierge moderne“. Zitiert nach: Pietraß, Richard (Hg.): „Edith Södergran. Klauenspur. Gedichte und Briefe“. Leipzig, 1990.
(2) Aus: Rosenkranz, Jutta. „Zeile für Zeile mein Paradies. Bedeutende Schriftstellerinnen“. München, 2014.
(3) Ebenda.
(4) Södergran, Edith. Aus dem Vorwort zu „Septemberlyra“, 1918. Zitiert nach: Pietraß, Richard (Hg.): „Edith Södergran. Klauenspur. Gedichte und Briefe“. Leipzig, 1990.
(5) Vgl. Rosenkranz, Jutta. „Zeile für Zeile mein Paradies. Bedeutende Schriftstellerinnen“. München, 2014.
(6) Zitiert nach: Ebenda.