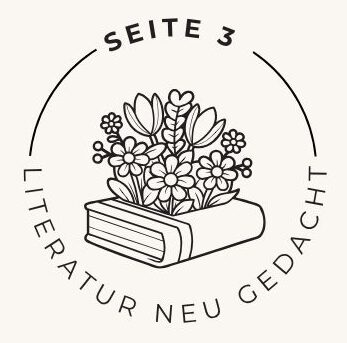Short Story vs. Kurzgeschichte – was macht den Unterschied?
Hast du dich auch schon gefragt, was genau der Unterschied zwischen einer Short Story und einer Kurzgeschichte ist? Sind es einfach nur englische und deutsche Bezeichnungen für Dasselbe – oder steckt mehr dahinter?
Short Story – mitten ins Leben gegriffen
Die Short Story stammt aus dem angloamerikanischen Raum und ist vor allem in der US-amerikanischen Literatur tief verwurzelt. Eine der ersten Kurzgeschichten der Weltliteratur ist „The Legend of Sleepy Hollow“ (Washington Irving, 1820).
Aber auch Autoren wie Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway und Katherine Mansfield haben das Genre geprägt.
Gut zu wissen: Die Short Story ist eng mit der Entwicklung des Zeitschriftenwesens im 19. Jahrhundert verknüpft. Denn kurze Texte ließen sich leichter abdrucken und fanden ein breites Publikum – damit boten sich den Autor/innen neue Verdienstmöglichkeiten.
Beispiel: Ernest Hemingways „Hills Like White Elephants“
In diesem Meisterwerk von 1927 entspinnt sich ein scheinbar belangloses Gespräch zwischen einem Paar an einem Bahnhof in Spanien. Zwischen den Zeilen entdeckst du jedoch, dass es um eine Abtreibung geht.
Hemingway verzichtet auf jede direkte Aussage – stattdessen dominiert sein berühmtes „Iceberg Principle“: nur ein kleiner Teil ist sichtbar, der Rest liegt unter der Oberfläche. Eine Technik, die für die Short Story typisch ist.
Aber was ist dann eine Kurzgeschichte?
Auch die Kurzgeschichte ist ein Kind der literarischen Moderne – knapp, pointiert, alltagsnah. In der deutschen Literatur hat sie seit den 1950er-Jahren einen festen Platz, geprägt unter anderem durch Autoren wie Wolfgang Borchert, Heinrich Böll oder – ein schönes Beispiel aus neuerer Zeit – Judith Hermann.
Damit ist der Unterschied vor allem historischer Natur: Die „deutsche Kurzgeschichte“ ist das Produkt der sogenannten Trümmerliteratur nach 1945. Sie stand für einen literarischen Neuanfang in einfacher Sprache und klarer Form – als bewusste Abgrenzung von der pathetischen, ideologisch aufgeladenen Literatur der NS-Zeit.
Mehr Unterschiede sind nicht zu finden – stattdessen viele Gemeinsamkeiten. Genau wie die Short Story verzichtet die Kurzgeschichte radikal auf Ausschmückung. Es gibt meist keine Einleitung, sondern du wirst direkt in eine Situation geworfen. Die Figuren sind oft namenlos, das Setting karg. Der Schluss? Offen, manchmal verstörend – erfordert deine eigene Deutung.
Beispiel: Wolfgang Borcherts „Das Brot“
In dieser Nachkriegskurzgeschichte (1947) geht es um ein älteres Ehepaar. In einer Nacht ertappt die Frau ihren Mann dabei, wie er heimlich Brot isst – ein stiller Verrat in Zeiten der Knappheit. Was folgt, ist ein leiser, spannungsgeladener Dialog. Kein dramatischer Höhepunkt, keine große Geste – aber eine erschütternde Tiefe, die lange nachhallt.
Es geht aber noch mehr!
Doch es gibt auch Short Storys & Kurzgeschichten, die auf die lakonische Erzählweise verzichten und viel opulenter gestaltet sind. Sie arbeiten auch stärker mit dramaturgischen Mitteln wie Spannungsaufbau, Plot-Twist oder einem pointierten Ende.
Diese Varianten bieten mehr narrative Tiefe: Charaktere sind klarer gezeichnet, die Handlung durchdachter konstruiert – fast schon wie ein Mini-Roman.
Ein perfektes Beispiel für eine solche opulent erzählte Short Story ist The Garden Party von Katherine Mansfield. Im Unterschied zu Hemingway und Borchert arbeitet sie mit viel atmosphärischer Dichte, detailreichen Beschreibungen und psychologischer Tiefe. Die Geschichte entfaltet sich fast beiläufig, doch gerade in dieser Leichtigkeit liegt ihre Kraft: Der Kontrast zwischen Partystimmung und existenzieller Armut trifft mitten ins Herz.
Laura, die Hauptfigur, bereitet mit ihrer Familie ein Gartenfest vor. Doch als sie erfährt, dass ein armer Kutscher in der Nachbarschaft tödlich verunglückt ist, möchte sie das Fest absagen. Ihre Familie hingegen reagiert kühl und verständnislos. Am Ende wird Laura mit einer Realität konfrontiert, die ihre privilegierte Welt ins Wanken bringt – ein Wendepunkt in ihrem sorglosen Denken.
Auf den ersten Blick haben die Arbeiten von Hemingway, Borchert und Mansfield viele Gemeinsamkeiten: Sie sind kurz, konzentrieren sich auf einen Ausschnitt des Lebens und verzichten auf große epische Bögen. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar:
- „Das Brot“ und „Hills Like White Elephants“ fallen durch ihre lakonische Erzählweise und viele Wiederholungen auf. Es fühlt sich an wie belangloser Alltag. Und doch stecken beide Geschichten voller Gesellschaftskritik – sie wollen irritieren, nachdenklich machen und leben von ihrem offenen Ende.
- „The Garden Party“ hingegen ist opulenter, setzt auf starke Gefühle und detaillierte Beschreibungen. Mit einer scheinbar zufälligen Struktur und einem spürbar kritischen Subtext baut Mansfield eine unvergleichliche innere Spannung auf, die viel emotionaler ist als bei Hemingway und Borchert.
Fazit: Zwei Seiten derselben Medaille?
Ja und nein. Du kannst beides synonym setzen, da der Begriff zuerst im Englischen geprägt und dann einfach ins Deutsche übersetzt wurde. Aber bei näherem Hinsehen sind Short Story und Kurzgeschichte nicht einfach austauschbare Begriffe, denn sie entstammen unterschiedlichen literarischen Traditionen. Und die deutsche Kurzgeschichte hat einen ganz speziellen historischen Background.
Wenn Du selbst schreibst, lohnt es sich, beide Formen (lakonische vs. opulente Erzählweise) auszuprobieren. Und wenn Du liest, achte mal bewusst auf die feinen Unterschiede!
Hier kannst du alle drei Geschichten direkt nachlesen:
Ernest Hemingway: „Hills Like White Elephants“, 1927:
Zu: Archive.org
Wolfgang Borchert: „Das Brot“, 1947:
Zu: Bildungsserver teachSam
Katherine Mansfield: „The Gardenparty“, 1922:
(Hier musst du etwas herunterscrollen, weil in diesem Band mehrere Short Storys sind.)
Zu: Gutenberg Projekt
Hinweis: Die hinterlegten Links führen zu externen Seiten. Für deren Inhalte übernehme ich keine Gewähr. Die Quellen wurden nach bestem Wissen ausgewählt.
↩️ Zurück zum Atelier